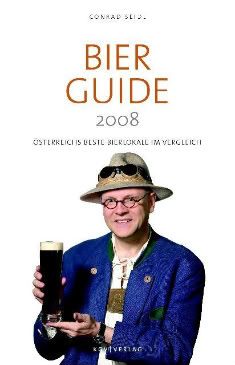Fassbier bleibt halt doch Fassbier
Ihre Erinnerung trügt.
Bei den hölzernen Bierfässern, aus denen freundliche Kellner das Bier für unsere Väter und Großväter gezapft haben, hatte das Bier selber nie Kontakt mit der hölzernen Innenwand des Fasses. Denn die Bierfässer von anno dazumal waren innen mit einer füssigkeits- und gasdichten Schicht aus Pech ausgekleidet – ansonsten wäre ein halbwegs gleich bleibender Kohlensäuregehalt im fertigen Bier gar nicht möglich gewesen, das Bier wäre womöglich schon schal geworden, ehe das Fass angestochen worden wäre. Noch schlimmer: die raue Oberfläche des Holzes hätte einen idealen Lebensraum für bierschädliche Mikroorganismen abgegeben, die frisches Bier im Nu sauer werden lassen.
„Damit das nicht passiert, müssen wir jedes Fass ausleuchten und überprüfen, bevor wir es frisch füllen“, sagt Christian Spatzenegger, der Braumeister des Augustiner Bräus in Salzburg. Das Augustiner-Bräu (Bierfreunden wegen seiner Lage im Stadtteil Mülln auch als „Müllner Bräu“ vertraut) ist die letzte Brauerei in Österreich, die ihr Bier noch in die hölzernen Gebinde füllt. Und das erfordert besondere Umsicht: Fässer, in denen die Pechschicht schadhaft erscheint, werden ausgeschieden und frisch gepicht. Etwa dreimal im Jahr wird dazu das alte Pech aus den schadhaft gewordenen Fässern herausgeschmolzen und durch eine frische Schicht ersetzt. Übrigens: Was der Brauer als Pech kennt, wird aus dem Harz von Föhren hergestellt, das etwa in den Wäldern an der niederösterreichischen Thermenlinie gewonnen wird: „Glücklich ist, wer ein Pech hat“, lautet dort eine nur scheinbar paradoxe Redewendung der Forstleute.
Die aufwändige Arbeit des Pichens -– mitsamt der Verpflichtung, die Fässer alle drei Jahre frisch eichen zu lassen – hat längst dazu geführt, dass Brauereien zu anderen Gebinden gegriffen haben: Das stählerne „Krupp-Fass“, Vorläufer der heute üblichen Kegs, wurde bereits in den dreißiger Jahren eingeführt. Es blieb aber ebenso wie das inzwischen gänzlich abgekommene Aluminiumfass von untergeordneter Bedeutung, so lange die Arbeitskraft in den Küfereien, Pichereien und Brauereien billig und der wirtschaftliche Druck zur Automatisierung gering war. Man kann sich kaum noch vorstellen, mit wie viel Handarbeit die Pflege der Fässer verbunden war: Bis weit nach dem Krieg wurden in vielen Brauereien nicht nur die für den Ausschank bestimmten Fässer (immerhin mit Inhalten von bis zu 100 Litern) mit Körperkraft bewegt und von Hand gepflegt – es mussten auch die riesigen, -zig Hektoliter fassenden hölzernen Lagerfässer nach jedem Sud händisch geschrubbt und Jahr für Jahr ausgekellert und im Brauereihof ausgebessert werden. Kein Wunder, dass zunächst die für die Reifung des Bieres wichtigen Lagerfässer durch Tanks aus Metall ersetzt wurden.
Die großen Braustätten erkannten dann aber die Vorteile, die die modernen Fässer auch beim Ausschank bieten: Roboterarme heben sie von der Palette, eine Waschanlage reinigt sie außen und innen mit Lauge, Säure und Heißdampf, füllt CO2 und schließlich Bier ein, das auf diese Weise perfekt gegen Verunreinigungen, aber auch gegen die zersetzende Wirkung von Luftsauerstoff geschützt ist. Heute sind Keg-Füller selbst für sehr kleine Brauereien erschwinglich – sogar Gasthausbrauereien können ihr Bier in Fässer füllen und anderswo ausschenken.
Und wenn man -– wie wir es auf unzähligen Festen beobachten können – ein schönes großes Holzfass bei einem Bieranstich sieht? Dann ist es oft eine mehr oder weniger kunstvoll hergestellte Attrappe: Ein Mantel aus Holz oder Kunststoff für ein kleineres Edelstahl-Keg. Mit entsprechenden Ventilen lässt sich auch in Kegs der Holzfass-Effekt simulieren. Dabei wird ein Zapfhahn für den so genannten „bayerischen Anstich“ in ein Ventil im unteren Teil des Fasses gedrückt, am Zapfkopf wird eine Belüftungsvorrichtung angebracht, damit das Bier langsam und nur mit dem Druck seines eigenen Gewichts aus dem Fass laufen kann.
Das nämlich macht die besondere Milde aus, die Bierfreunde an den alten Holzfässern so gelobt haben: Anders als in modernen Schankanlagen wird das Bier in solchen Gebinden nicht mit CO2 herausgedrückt – was zu einer mehr oder weniger starken Anreicherung mit dem prickelnden Gas führen kann – sondern bleibt so mild, wie es eben aus dem Lagertank gekommen ist. Der Nachteil liegt in der geringen Haltbarkeit des Fassbieres, wenn es einmal angestochen ist: Weil eben kein zusätzliches CO2 im Spiel ist, wird der Inhalt eines Fasses schon wenige Stunden nach dem Anzapfen merklich schaler; die Kohlensäure entweicht eben nach und nach. Das macht auf einem zünftigen Oktoberfest oder beim Bockbieranstich nichts, denn da wird ja ein einmal angezapftes Fass typischerweise schnell leer getrunken. Auch jene wenigen Gaststätten, die noch Bier aus echten Holzfässern beziehen – das Augustiner-Bier gibt es nicht nur im bekannten Müllner Bräustübl, sondern etwa auch beim „Bamkraxler“ in Wien vom Holzfass – achten sehr darauf, dass ein einmal angestochenes Fass auch rasch leer gezapft wird.
Heikel wird es, wenn man Fassbier für daheim will. Denn da weiß man oft nicht, wie weit man sich auf den eigenen Durst und den der Gäste verlassen kann – der Inhalt so manchen Partyfasses musste schon weggeleert werden, weil das Fass am Vorabend nur zur Hälfe leer getrunken wurde. Und für jemand, der an einem Fernsehabend zwei, drei Seiterln Bier vom Fass trinken will, gilt es ohnehin, ein Lokal mit gepflegtem Bier, großer Videowand und dem richtigen Fernsehprogramm zu finden – was eine gewisse Herausforderung darstellt.
Nun aber haben zwei Bierkonzerne – Inbev und Heineken – gemeinsam mit Haushaltsgeräteherstellern ein Zapfsystem für daheim entwickelt. Beer-Tender heißt das Gerät von Krups, das für den stolzen Preis von 249 Euro Fassbiergenuss für daheim bietet. Allerdings mit der Einschränkung, dass die dafür vorgesehenen 4-Liter-Fässer nur mit Zipfer, Gösser oder Heineken-Bier ausgeliefert werden. Immerhin: das Zapfvergnügen ist groß und das Bier bleibt tatsächlich tagelang hält. Versprochen sind 30 Tage, aber so lange wird ohnehin niemand brauchen, um die vier Liter zu trinken.
Und tatsächlich zeigt sich, dass das Bier aus dem so genannten Beer-Tender nicht nur gut kühl, nicht nur mit einem schönen, feinen Schaum, sondern vor allem auch sehr kohlensäurearm gezapft wird: Anders als in konventionellen Schankanlagen wird dem Bier kein zusätzliches CO2 zugesetzt, weil der Zapfvorgang aus einem Plastiksack erfolgt, der sich im Inneren des Fässchens befindet (das seinerseits in das Innere des Beer-Tenders eingesetzt wird). So kommt kein Zapfgas dazu und es geht auch keines verloren.
So zu zapfen haben sich wahrscheinlich Brauer seit Jahrzehnten gewünscht. Weil gute Brauer aber an sich nie mit dem Erreichten zufrieden sind und immer noch etwas besser machen wollen, muss noch etwas nachgetragen werden: Tatsächlich gibt es seit wenigen Jahren Biere, die in richtigen Holzfässern und mit Kontakt zum Fass nachgereift werden. Kevin Marley von Denver Chop House & Brewery (einem Pub aus der erfolgreichen Rock-Bottom-Kette) hat auf diese Art schon 1997 ein „Wild Turkey Bourbon Stout“ gebraut, das in einem alten Whiskyfass nachreift und einen ausgesprochen milden Charakter hat. Ein Großteil der Kohlensäure diffundiert ja durch das Holzfass, dafür gibt dieses ein Vanille-Aroma des Whiskies an das Bier ab. Axel Kiesbye, der Creativ-Brauer aus Obertrum, hat die Idee nach Österreich gebracht und bei der 1516 Brewing Company ein „Triple Barrique“ gebraut, ein kräftiges, leicht schwefelig wirkendes Ale, das ausnahmsweise wirklich einen Holzton ins Bier bringt.
(Erstveröffentlichung in: Falstaff November/Dezember 2005)